![]() Download der Hintergründe sowie des Inhalts der Oper im
RTF Format als Zip Datei
Download der Hintergründe sowie des Inhalts der Oper im
RTF Format als Zip Datei![]() Inhalt
der Oper
Inhalt
der Oper
POD UKVALY (1854)
von Leos Janácek
Zur Welt kam ich am 3. Juli in der Schule, in jener Stube,
die mit dem einen Fenster auf die Kirche, mit dem andern auf das Brauhaus
blickt.
Die Schule von Ukvaly; eine mächtige Stube, alte rissige Bänke.
Die eine Klasse links - für die Kleinen, die zweite rechts - für die
Größeren. Zwei Tafeln, der Vater und der Unterlehrer unterrichteten
gleichzeitig. Wie kamen sie wohl miteinander aus? In der Ecke ein großer
Herd, daneben ein Bett; das Nachtlager des Unterlehrers. Ich mußte dieses
Bett hüten, als ich mich am Herd verbrannt hatte.
Eng ist die Welt des Huhns. Auch meine - des Kindes Welt: Der Schulhof mit
den Enten, die Kuh im Stall. Im Laden U Gobru". Das Häuschen meiner
Schwester Viktoria mit dem Webstuhl. Unter dem Wald, wo das Bächlein
Kinder von der Babi hura brachte. Unser Bienenhaus; es war nicht einmal
komplett, hatte aber achtundvierzig Bienenstöcke! Noch immer sehe ich in
ihrem dunklen Innern den Honig schimmern.
Wie doch der Sinn des Kindes an den Einzelheiten hängt!
Sie bedeuten ihm alles. Als wären andere Umstände versunken.
Feuer! Flammenzungen lecken am Dach des Brauhauses, knapp neben der Schule
- in einer Sommernacht ! Uns Kinder trug man im Bettzeug auf den Abhang der
Wildbahn, über der Marienstatue. An mein Weinen erinnere ich mich.
Stoffschuhe an den Füßen, die Weihnachtskerze in der Hand, geht
es auf verschneitem Pfad zur Mitternachtsmette. Unter der Wildbahn, von der
Seite, wo die Mühle liegt, flackern die Laternen der Fußgänger.
St.-Andreas-Wallfahrt auf das alte Schloß. Frühwinter im Wald;
schwer fällt der steile Anstieg im Neuschnee.
Ich liebe meinen Berg, die Babi hura; dicht stehen ihre Baumstämme
und verlieren sich irgendwo im Unabsehbaren des Abhangs. Große, bissige
Ameisen. Man vergißt Heidelbeeren zu pflücken .
Mir ist bange. Der lange Rain! Nur ein Stück ist zu sehen; ein Pfad
taucht auf, wohin er führen mag? Grau ist er und grün der Rain, ein
Kind tollt hier umher.
Podzámci.Die Wände des Schlosses sind getüncht, aber das
Gebäude und die Fenster entgehen dem Blick. Nur ein lärmender Haufe
fremder Menschen - immer summt er vor dem Eingang wie ein dunkler
Bienenschwarm am Flugloch.
Ohne Trommeln. (1861)
von Leos Janácek
Zwei Nachbardörfer. Das eine liegt hoch auf dem grünen Bergeshang: Aus den Fensterchen des anderen in der weiten Ebene kannst du es sehen. Munter springt das klare Wasser der Ondrejnica über die Steine des Bergdörfchens Pod Ukvaldy und plätschert dann lässig zwischen den Gärten von Rychaltice.
In den sechziger Jahren lebten die würdigen Rektoren der beiden Gemeinden in aufrichtiger Freundschaft. Dem einen hatte der Herrgott viele Kinder beschert - dem auf der Waldseite -, den anderen mit irdischen Gütern gesegnet.
Musik und Bienen waren die einzige Freude des Rektors von Hukvaldy. Wenn man ihn einlud, kam er auch in die Kirche der reichen unteren Pfarre zum Musizieren. Mit dem Vater wanderten die Kinder. Ich mit meinem schönen Diskant, die Schwester mit ihrer Viola; den ganzen Chor füllten wir Sänger und Musikanten.
Der Vater führte seine Sonntagsgäste am liebsten in den unteren Teil des Gartens, zum Bienenhaus. Die Stöcke standen rechtwinklig in einer Doppelreihe. Ihre Fluglöcher blinzelten, drolligen Äuglein gleich, der Morgensonne entgegen, wenn sie links vom Kaznicov aufging.
Schön war der Sonntag! Der Rektor von Rychaltice hatte sich wieder einmal auf den Weg gemacht, um den von Hukvaldy zu besuchen. In der Gartenlaube unter hielten sich die beiden, betrachteten. die Bienenschwärme. Dann reinigten sie die Gucklöcher von Spinnweben, denn sie wollten die emsige Arbeit der Bienen sehen. Allzuleicht vergaßen sie dabei uns Kinder. Den Honig von Teller und Messer zu lecken, damit waren wir bald fertig.
Das Dach des herrschaftlichen Eiskellers neigte sich bis zum Weg. Ein Schritt genügte, und schon rutschten wir vom First des glasglatten, funkelnagelneuen Daches hinunter. So stark erhitzte die Sonnenglut das Zinkblech, daß man es mit der Hand kaum anfassen konnte.
Merkwürdig, alles andere ist meinem Gedächtnis entfallen. Ich erinnere mich nur an die Musterung der Feiertagshosen, die noch auf der Straße stattfand.
Die beiden Herren Rektoren kehrten diesmal allzubald aus dem Garten zurück. . .
Daß ich Hänschen aus Rychaltice an diesem heißen Feiertagsnachmittag zum Dachrodeln" verführte, mag kaum der Grund gewesen sein, weshalb sich ihre Freundschaft so jäh abkühlte. Warum fühlte auch ich, der siebenjährige Junge, das so deutlich?
Niemals mehr gingen wir an Feiertagen nach Rychaltice singen und spielen. Aus war es ! Und dabei hatten sie dort eine Menge breiter Pulte, eine vergoldete Orgel mit vielen Registern an beiden Seiten des Manuals, und hinten, ganz am Fenster, zwei Pauken, groß wie Backtröge.
Der Ostersonntag näherte sich. In der Schule legten wir die Noten auf die Bänke, setzten uns an sie und übten die Messe, nur für uns in Hukvaldy. Was nützten aber die Geigen und feierlichen Trompeten, die Klarinetten? Nein, ohne Trommeln geht es nicht, ohne Trommeln ist es nicht festlich genug !
Die abendlichen Schatten der uralten Bäume legten sich dicht über die Raine, die zur Kirche führten.
Komm, fürchte dich nicht ! Schon sind wir beim Friedhof." Hu ! Das Tor ist offen, auch der Kirchenvorraum. Alles noch voller Weihrauchduft nach der Auferstehungsfeier. Über knarrende, ach wie furchtbar knarrende Stufen geht es auf den Chor .
Und wir schleppen die Pauken querfeldein über Stock und Stein nach Hukvaldy. Als ob sich die Hügel uns zum Trotz erhoben hätten; der Schweiß floß aus allen Poren.
Wie man uns empfing, weiß ich nicht mehr. Auch nicht, wie die Trommeln wieder an Ort und Stelle kamen, dort an das Fenster des Chors in Rychaltice.
Unsere Messe war allerdings nicht großartig. Ohne Trommeln. Dafür tanzten ihre Schlegel auf meinem Rücken, zum Überdruß.
Ob meine Wallfahrt mit den Pauken unsere Väter versöhnt hat? Ich weiß es nicht.
Nun ruhen sie beide, wohl einträchtig, in der Nähe der Kirche . . .
PRAG WEISS VON ALLEDEM NICHTS
Max Brod über Janácek, Böhmen und Mähren
Was ist Brünn? Liegt schon Prag etwas abseits der großen europäischen Kunstzentren, so liegt gar Brünn sogar abseits von Prag. Im alten Österreich betrachtete sich Brünn als eine Vorstadt von Wien. Es gibt in Brünn einen Augarten, einen Stadtpark, sogar eine Art Ringstraße alles Klein-Wien. Man fuhr nach Wien in die Oper, zum Schneider, und so fort. Dann kam der Umsturz, mit ihm die gefürchtete Zollgrenze Lundenburg. Von Prag ist Brünn, die Hauptstadt Mährens, Tuchmetropole, zweitgrößte Stadt der Tschechoslowakei, immerhin sieben Schnellzugstunden entfernt. Das stört den Zusammenhang.
Da aber Janáceks »Tagebuch eines Verschollenen« in Brünn seine Urauflührung hat, sind mir sieben Schnellzugstunden nicht zuviel. Ich fahre zu Janácek.
Charakteristisch, daß keine der großen tschechischen Zeitungen oder Revuen Prags einen Berichterstatter geschickt hat. Die Prager Künstler sind sehr hochmütig. Sie erkennen Janáceks Bedeutung allmählich an, man sieht seinen Namen heute schon auf jedem Konzertprogramm von Rang. Aber er gilt doch nur als einer unter den übrigen. Daß er das Genie schlechthin ist, das heute unter den Tschechen lebtes ist nicht leicht (zugestanden), einem Mann, der in Brünn wirkt, die Palme zu reichen. Doch das sind innertschechische Schmerzen, die mich glücklicherweise nichts angehen.Ich fahre nach Brünn, ich fahre für mich allein, zu meinem besonderen Vergnügen, einer Kunsterschütterung entgegen, die heute noch wenige außer mir zu würdigen wissen. Ich fahre wie zu geheimen, verbotenen Genüssen. Ist es meine Schuld, daß sie geheim sind? Ist es meine Schuld, daß ich, der "Deutsche", einziger auswärtiger Gast einer denkwürdigen Premiere werde?
Als Dreingabe: Brünn. Eine Stadt, die der Zufall gebaut zu haben scheint. Sinn und Stil hat der mächtige Gürtel von Fabriken ringsherum. Aber die Stadt selbst? Es sieht fast so aus, als hätten die Fabriken so lange Häuser und Häuschen »emaniert«, bis mitten zwischen den Fabriken als notwendige Wohnstätte der Fabrikbeschäftigten eine Stadt fertig war. Sie geht bergauf, bergab. Zum Unterschied von der Siebenhügelstadt ist hier jede Gasse ein Hügel für sich. Der Hauptplatzdreiseitig. Ein Unikum. Man merkt sofort: dieses Zentrum (wie alles übrige) hat man nicht planmäßig, grundrißmäßig angelegt, sondern die »emanierten« Häuser sind einfach solange zusammengerückt, bis sie sich nicht weiter rühren konnten, und da ist dann zufällig dieser dreieckige, abschüssige Marktplatz übriggeblieben.
In diesem Brünn schafft seit Jahrzehnten Janácek, schafft unermüdlich,
lehrt, bildet eine Schule, eine neue Musiktheorie, schreibt Opern, Lieder, Chöre,
AbhandlungenPrag weiß von alledem nichts, so gut wie nichts. Janácek
ist heute weit über sechzig Jahre alt.
Erst seit vier Jahren spielt man seine Musik in Prag.
Im Jahre 1916 tauchte plötzlich seine Oper "Ihre Ziehtochter" (Jenufa) auf dem Prager Nationaltheater auf. Sie erlebte einen in der Geschichte der tschechischen Opernliteratur beispiellosen Erfolg. Völlig originell, wie aus dem Nichts emporgeschossenso stand plötzlich die Welt ostmährischen Volkstums vor den Pragern. Man berauschte sich an diesen neuen Melodien. Und die Kenner standen betäubt vor einer abseitigen und doch so natürlichen Art der Harmonik, Rhythmik, der Wortdeklamation, der Orchesterbehandlung, kurz, vor der Totalität eines Musikphänomens. Immer und immer wieder wurde die Oper gespielt. Sie hat sich heute schon ins Volksbewußtsein geprägt wie Smetanas "Verkaufte Braut". Ein Standardwerk, das sich nicht nur in Prag, sondern nach dem Prager Ereignis an allen tschechischen Bühnen dauernd auf dem Spielplan erhält. (Deutsche Aufführungen in Wien und Köln erfolgreich.)
Nun aber kommt das Seltsame, das Beschämende, das Skurrile: diese Standardoper war gar keine Neuheit, sie war am Tage ihrer Prager Erstaufführung bereits zwölf Jahre alt gewesen. Und nicht nur das: sie war im Jahre 1904 in Brünn uraufgeführt worden, hatte sich dort all die zwölf Jahre hindurch ständiger Wiederholungen, großer Beliebtheit erfreut! Und dennoch, dennoch: die Prager Herren hatten es nicht für nötig befunden, diesen »Provinzialismus« näher in Augenschein zu nehmen.
Das Erstaunliche, daß Janacek durch all die Enttäuschungen seines Daseins nicht verbittert worden ist. Er lebt im Glück einer völlig jugendlichen, ungebrochenen Schaffenskraft. Auch äußerlich eher ein Fünfundvierzigjähriger als ein Fünfundsechziger! Sieht man ihn, hört man seine ehrlichen, temperamentvollen und treffsicheren Bemerkungen, so beginnt man doch wieder zu glauben, daß Gott mit der Menschheit Größeres vorhat, als der tägliche Anschein lehrt.Oh, wie deutlich fühlt man: nichts geht über das Wunder der Hingegebenheit. So einfach lebt dieser Einzige, Stille in Leidenschaft für seine große Sache. Er setzt sich nicht in Szene, er versteht es gar nicht, aber er merkt nicht einmal, daß dieser Mangel ihm schadet. Vor allem ist ihm nur seine Arbeit wichtig. Daß sie dann liegenbleibt, daß sogar heute noch, nach dem durchschlagenden »Jenufa«-Erfolg, der größte Teil seiner Werke ungedruckt daliegtes ärgert ihn wohl, es ist ihm nicht angenehm. Aber daß er Anstalten treffen würde, diesen Übelstand abzuhelfen, das merke ich nicht.
Es ist so herrlich, daß es immer noch Künstler gibt, die nicht wissen, »wie's gemacht wird«.
Sie leben wohl so wie Janácek. Im Vorstädtchen einer Provinzstadt. In einem Garten, in einem kleinen Parterrehäuschen, das bescheiden, doch ganz nach eigenem Zuschnitt eingerichtet ist. Von der Straße her ist es nicht zu sehen. Von der Straße her verdeckt diesen Privataufenthalt das große öffentliche Werk, Janáceks Orgelschule. Auch dies ist ein einfaches und nicht sehr beachtetes Gebäude, doch edel, hell, mit griechischen Tempelsäulen geschmückt. Jahrzehntelang nur Vereinsbesitz, heute vom Staat übernommen, so daß der Meister wenigstens finanzieller Sorge überhoben scheint. Hier trägt Janácek vor.Hier hat er Scharen tüchtiger Musiker erzogen. Überflüssig, zu bemerken, daß seine unschätzbar eigenwilligen Vorlesungen ungedruckt sind.
Denn Janácek ist auch als Theoretiker originell. Etwa gleichzeitig mit Charpentier und Mussorgski, alle drei unabhängig voneinander, hat er die Oper in Prosa, den musikalischen Reichtum der natürlichen Menschenrede, entdeckt. Während aber Charpentier in seine "Luise" die Pariser Gassenschreie naturalistisch, als Zitate einflicht, ist für Janácek der beobachtete Tonfall täglicher Gespräche nichts als Rohmaterial. Er lehrt, daß der Musiker ganz ebenso wie er heute Harmonielehre und Formenlehre lernt, um sie zu vergessen, um sie in seiner Praxis nur ganz instinktiv anzuwendendaß der Musiker ganz ebenso die »Sprechmelodien« in ihrer ganzen ungeheuren Fülle studieren soll, nicht um sie nachzuahmen, sondern um auf diese Art der konventionell-musikalischen Phrase zu entgehen. Die unausschöpflichen Reichtümer der Natur als Arkanum gegen die Schablone, nicht als Eselsbrücke formloser Impotenz dies seine (selbstverständlich von Ästhetikprofessoren als Realismus mißdeutete) Grundtheorie. Mehr als Theorie: es ist das Gefühl seiner eigenen Lebendigkeit und elementaren Kraft, an Goethesches Lebensgefühl anklingend. Wie bei Goethe halten sich in seiner Kunst energischer Stilwillen und lebensvolles Detail die Waage.
»Jenufa« ist keine tschechische Nationaloper, sie hat nichts mit nationalen historischen Träumen zu tun wie etwa Smetanas »Dalibor«, der ein Entzücken des Hofopernpublikums bildet. »Jenufa« ist eine menschliche Oper, die unter mährischen Bauern spielt. Ein Drama höchster Liebe, höchster Aufopferung für den Nächsten! Ein Drama des zarten Gewissens und des einen Augenblick lang betäubten Gewissens, das in Schuld gerät und zum Schluß vor der ganzen Welt öffentlich seine Schuld gesteht. Ein Drama, dessen Schlußworte zweier Liebender so lauten: Laca: Du gehst in die Welt hinaus, fängst wieder ein Leben an, und mich willst du nicht mitnehmen, Jenufa? Jenufa: Laca, man ruft mich vor den Richter, verachtungsvoll wird sich jedermann von mir abwenden. Laca: Jenufa, das will ich gern ertragen, das will ich gern ertragen. Uns kann kein Leid geschehen, sind wir beide zur Tröstung beisammen!Jenufa: O Laca, liebste Seele! O komm, o komm! Jetzt fühl' ich im Herzen die Liebe, die größere, die Gott selbst, der Herr, gern hat! . . .
Damals, als ich die Übersetzung begann, beschäftigten mich ganz andere Bedenken. Die unendliche Schwierigkeit meiner Aufgabe, in die ich mich nun für ein Vierteljahr völlig vergrub. Janáceks eigenartige, auf seine besondere Musiktheorie gestützte Deklamation, die den von ihm entdeckten »Wortmelodien« nachgebildet istdazu der Rhythmus der tschechischen Sprache, die jedes, auch das längste Wort auf der ersten Silbe betont und so ziemlich das Entgegengesetzteste des deutschen Wortakzents bie tet, der slowakische Dialekt, den ich durch eine auf keine bestimmte Lokalität eingestellte Einfachheit wiederzugeben suchte... Wären mir alle diese Klippen von Anfang an bewußt gewesen, ich hätte die Arbeit kaum begonnen.
Eines rettete mich: die Freude, einen Operntext zu schaffen, der mit »Operndeutsch« nichts zu tun hat. Man kennt diesen Jargon, in den Meisterwerke wie »Carmen« und andere übersetzt sind. »Geliebte, hör' mein Flehn«, heißt es da immer wieder, und der bäurisch-robuste Einleitungschor der »Verkauften Braut«, der im Original ganz schlicht sagt: "Wir freuen uns unseres Lebens, solang' uns Gott Gesundheit gibt", muß folgende Perversion erdulden: »Seht am Strauch die Knospen springen, hört die muntern Vögel singen usw.«Ach Gott, die lieben guten muntern Vögel! Zehntausend Meilen jenseits dieser Geistesprovinz mein Reich aufzuschlagen: das war der Sinn meiner Arbeit.
Ich hatte den Ehrgeiz, eine Libretto-Prosa zu schreiben, die der musikalischen Dynamik auf das genaueste folgt, ohne dabei in eine nur auf Opernbühnen übliche Wortumstellung ( »Zur Kaserne dich dränge!« und ähnliches, ohne in die Flickworte »da« und »nun«, ohne in eine Lyrik zu versumpfen, die von Anfang bis zu Ende ein einziges Flickwort ist . . .
Menschlichkeit, nicht Opernhaftigkeit!Menschlichkeit, nicht Nationalitätenhaß!Es ist nicht leicht, mit so selbstverständlichen Prinzipien im Wahnsinn dieser Zeit »durchzuhalten«.
WENN EINER KÄME UND SIE AN DER HAND NÄHME . . .
Gabriela Preissovás Erzählung zur Vorgeschichte der Opernhandlung von "Jenufa"
In einer lieblichen Landschaft in Mähren, weitab vom Lärm der unruhigen Städte, lag das reizende Dörfchen Bystranka. Seine Häuser und Gehöfte waren in einem Gebirgsschoß weitläufig verstreut. Alles schien sanft zu schlafen; zumindest für einen Fremden hatte dieser Anblick etwas Idyllisches.
Vom Dorf ein gutes Stück entfernt, lag Slomeks kleines Bauernhaus, umgeben von prächtigen Kastanienbäumen.
Der Kleinbauer Slomek wurde regelmäßig zum Dorfrichter von Bystranka gewählt, obschon es in der Gegend angesehene Familien, wie die des Müllers, des Wirtes und auch einige Großbauern gab. Slomek aber galt als beispielhaft fleißig; Geiz oder Hamsterei waren ihm fremd, und das war sicher sein Vorteil. Längst fühlten sich die Slomeks in Bystranka heimisch, und ihr größter Stolz waren die beiden Töchter Halka und Petrona. Die Eltern hielten auf sie und ließen sie nicht, wie es in Bystranka sonst üblich war, die Gänse hüten. Sie schickten sie zur Schule ins Nachbardorf. Den Garten durften sie ganz nach ihrem freien Willen verschönern; für andere Arbeiten hatte der Dorfrichter einen Hirten, und im Haus die Tante.
Von Petrona selbst allerdings hatte auch noch keiner behauptet, daß sie zu einer Schönheit heranreifen würde. Petrona war dunkelhäutig, die Wangen ohne liebliche Rundungen. Die schwarzen, auffallend stark zusammengewachsenen Augenbrauen bogen sich bis zu den Augenwinkeln, und noch dazu zeigte sich oben auf der linken Wange ein schwarzes Muttermal. Dieses Mal hatte ihr von ihren Mitschülerinnen schon manchen Spott eingetragen. Und wenn sie in den Spiegel sah, blickte ihr eher ein Bursche entgegen als ein Mädchen. Aber dennoch hatte sie seit jeher einen fast leidenschaftlichen Sinn für alles Feine. Brennend nahm sie jede, für andere offenbar verborgene Schönheit auf. Bloß, erzählen konnte sie es keinem.
Sie brauchte keine Freundinnen, wollte nie eines der anderen Mädels für sich gewinnen. Von den Albernheiten, mit denen sie sich abgaben, wollte sie nichts wissen.
Auch aus dem größten Vergnügen der Jugend, dem Tanzen, machte sie sich nichts. Dieses Herumgehüpfe in den Armen eines angeheiterten Jünglings schien ihr unsinnig und aus ureigenem Feingefühl heraus nicht anständig.
Da dem Dorfrichter kein Sohn geschenkt wurde, hatte er die Petrona unwillkürlich wie einen Burschen großgezogen. Sie verstand es Pferde zu kutschieren, das Feld zu beackern und mähte wie ein geschickter Landwirt. Als ihr Vater einmal klagte, er fühle sich nicht wohl, irgendwie wäre ihm schwindlig, da ist sie auf das Hausdach gestiegen und hat selbst die Schindeln ausgebessert.
Immer wieder lockten sie die anderen Mädchen, das schönste Vergnügen der Welt das Tanzen doch wenigstens ein einziges Mal auszuprobieren. Aber die Antwort der Petrona war immer die einer alten Muhme: »Dieses wilde Herumdrehen soll eine Freude sein? Wenn Ihr Euch die Ohren zuhalten würdet und diesen torkelnden Gestalten nur zuschaut, dann seht Ihr selber, was für ein Unsinn das ist!« Aber diese Worte stammten nicht von Petrona,der Vater sprach aus ihr. So hörte das Gerede unter den Dorfmädchen nie auf, die Petrona wär' halt sonderbar.
Die häuslichen Vorzüge der Petrona hatten sich zwar längst herumgesprochen, aber kein Freier suchte sehnsüchtig ihre Nähe. Es fehlte auch nicht an wohlmeinenden Heiratsvermittlerinnen, die in der Wohnstube der Slomeks recht vernünftige Vorschläge für eine Eheschließung mit diesem oder jenem Jungbauern vorbrachten. Aber Petronas Herz schien verschlossen. Und wenn auch nie ein Freier unter ihrem Fenster einen Pfad festgetreten hatte, so war es ihr doch genug, daß die Blumen auf dem Fenstersims in voller Pracht erblühten. Manchmal jedoch vernahm sie von weit weg Laute einer Ziehharmonika aus dem Dorf oder einer Binsenflöte von anderswo, aber da war immer nur ein einziges Lied von hunderten, das sie wirklich berührte:
"Mädel, heirat' noch nicht, Viel mehr als die Braut hat ein Mädel es besser. Ein Mädel lebt ohne Pflicht Wie ein Fischlein im frischen Wasser."
Petrona empfand keine Traurigkeit, wenn sie diese lockenden Weisen aus dem
Dorf hörte. Hier, in ihrem
In der letzten Zeit überfielen sie an den stillen Abenden diese quälenden Gedanken immer öfter. Früher hatten ihr die Gespräche mit Väterchen all das ersetzt, was den anderen Mädchen so wichtig schien, aber schon bald nach seinem Tod fing sie an ihre innere Einsamkeit deutlicher zu spüren.
Zwar meldete sich eine ganze Reihe von Männern und Burschen, die ein tüchtiges Weib hätten haben wollen, aber Slomeks Petrona stellte sich gegen jeden Antrag wie ein wildes Tier. Wahrscheinlich hatte die Mutter doch recht,so ein Kerl würde sich hier hereinsetzen und nach seinem Willen walten. Da war es doch hundertmal besser, ledig und unabhängig zu bleiben, als sein Herz zu verkaufen und dazu noch jemandem die Herrschaft über sich selbst zu überlassen.
Und doch, wenn einer käme und sie an der Hand nähme und sanft seinen Arm um sie legte,unerschütterlich würde sie mit ihm den beschwerlichen Weg eines gemeinsamen Lebens gehen, einer dem anderen gleich verbunden. Aber niemals würde sie unterwürfig den Anordnungen des Mannes gehorchen, wie ihre Mutter es immer getan hat. Selbständig wollte sie alle ihre Fähigkeiten zur Entfaltung bringen, ihren Willen im Haus ungebrochen durchsetzen. Ihr Auserwählter müßte ihr vertrauen;wissen, daß sie immerfort nur das Beste will. Und es eben auch am besten meint; ist sie doch Slomeks Tochter, der sein Leben lang nur das Richtige getan hat. Daß ihre Kinder wohlgeraten zur Welt kommen würden, daran zweifelte die Petrona nicht, und deren Erziehung sollte anderen zum Beispiel dienen.
Sie konnte den Toma Buryja nicht vergessen. So wie er sich zu ihr auf den Wagen geschwungen hatte und dabei im Hinsetzen ihren Schoß streifte, so kühn schlich er sich jetzt in ihre Träume ein. Ganz deutlich sah sie seine blauen Kinderaugen vor sich. Immer wieder wollte er ihr ein Märchen vom Zauber einer warmen Nacht erzählen.
»Die Seele läßt sich von dieser Schönheit ganz erweichen, meine Liebe«, wiederholte er sanft...
Aber er hatte ihr nicht zu Ende gebeichtet, wohin er sich verirrt hatte, wenn er nachts aus dem Klumschitzer Wirtshaus ging.
Manchmal saß sie abends auf der Bank vor dem Haus, ihr Blick schweifte über die liebliche Landschaft und sie versuchte Tomas Gedanken nachzuempfinden. Auch wanderte sie im Garten herum, und einmal wagte sie sich sogar bis zum steilen Hang, der sich vom Gartenzaun bis zum Fluß hinabzog.
Mein Gott, könnte sie ihm bloß etwas von ihrer Vernunft abgeben; er war nur zwei Jahre jünger als sie, aber vielleicht könnte sie auf ihn einwirken, grade so, wie sie es mit den Kindern ihrer Schwester tat, die manchmal in ihrer Obhut waren.
E s dauerte quälend lange, bis es dem Toma einfiel bei Petrona vorbeizukommen, um sich den Bienenstand anzusehen, wie er es ihr doch versprochen hatte `
>,Wollten Sie sich nicht meine Bienenstöcke ansehen?« Sie führte Toma zum Bienenstand; er solle sich dort ruhig umschauen, während sie kurz ins Haus gehen wollte, sie wäre gleich zurück.
Als sie nach einer Weile in ihrer Sonntagstracht zurückkam, mit ihrer schönsten Schürze und dem fast neuen Kopftuch, schien das der Toma gar nicht zu bemerken.
Petronas Herz klopfte schneller. Wie verlockend war es zuzuhören, wie lieblich verlockend! Wenn jetzt dem Toma in den Sinn käme, sie solle mit ihm Hand in Hand, aus lauter Übermut, über den hohen Gartenzaun springen und wer weiß wohin weglaufen, sie würde es seinetwegen tun .Für solch einen einzigen wonnigen Augenblick könnte sie ihren ganzen angeborenen Ernst vergessen.
Als sie aber kurz nach Weihnachten erfuhr, daß Toma die Wirtstochter von Klumschitz, Jenufa, heiraten wird, wurde sie bleich wie Schnee. Das also war das Geheimnis jener Abende und Nächte, von denen er ihr so oft vorschwärmte Von der Jenufa hatte er dabei niemals gesprochen und auch mit keinem Wort erwähnt, welch entscheidender Schritt vor ihm lag. Petrona hatte immer treu zu ihm gestanden, und doch war er zu ihr nicht aufrichtig gewesen.
Toma war mit seinem Anteil, den ihm sein älterer Bruder voll ausbezahlt hatte, in das Wirtshaus seiner Schwiegermutter gezogen und wollte sich dort auch als Schankwirt nützlich machen. Aber da er mit den Gästen trank und beim Kartenspiel immer jemanden, der gerade fehlte, vertreten mußte, fand er nie das richtige Maß. Bald schon benahm er sich wie ein aufsässiger Gast, den die Frau und die Schwiegermutter bedienen sollten.
Schlimmer als das aber war sein Hang zum Kartenspiel. Er verspielte jetzt weit mehr als in seiner Junggesellenzeit. Alles Zureden seiner Leute half nichts, er war nicht zu bremsen; nach und nach wurde sein Geld immer weniger, bis die bei den Frauen davon den Verwandten und mitleidigen Bekannten erzählten, die es wiederum mitleidlos weitertrugen.
Der Petrona taten die Eheleute aufrichtig leid, und als sie erfuhr, wie sehr sich Toma über die Geburt seiner Tochter freute, sagte sie sich: >>Er hat also doch ein gutes Herz, der Toma, und jetzt wird er sich seines Kindes wegen sicherlich bessern.«
Seine Frau hat dieses Glück nicht mehr erlebt. Noch im Wochenbett überkam sie eine untrügliche Ahnung, und bevor sie starb, bat sie ihren Mann flehentlich: »Toma, wenn mich der Herrgott zu sich ruft, suche eine brave Frau als Ziehmutter für unsere Jenufka, damit mir das Herz im Grab nicht wehtut.«
Als dann nach nicht ganz vier Monaten Toma Buryja unter den blühenden Kastanienbäumen vor Slomeks Bauernhaus stand, seinen Hut abnahm und ihn von einer Hand in die andere drückte, trat ihm Petrona entgegen wie einem unabwendbaren Schicksal. Seit dem Tod seiner Frau war er wie verwandelt, warum sollte gerade sie ihm nicht trauen ?
Langsam streckte sie ihm ihre Rechte entgegen, und aus ihren Augen sprach demütige Hingabe. Toma ergriff ihre Hand, und an die Gunst der Mädchen gewöhnt, zog er Petrona geschickt an sich und nahm sich den verbindenden Kuß.
Ihm schien es nur recht und billig, um seine erdrückenden Sorgen loszuwerden, aber für die fast dreißigjährige Petrona, die zum ersten Mal von einem Mann geküßt wurde, war dieser Augenblick ein unerschütterlicher Wink des Schicksals. Mit diesem Kuß hatte Toma Buryja ihre gemeinsame Zukunft besiegelt; und selbst wenn er eines Tages, um all seinen Liebreiz gebracht, vor ihr stünde, nie mehr könnte sie sich von ihm abwenden.
Mit dem Glauben an ein neues Leben gingen sie zum Haus zurück.
Toma Buryja brachte mit seinem Töchterchen Jenufa nur eine schön bemalte Wiege und seinen Militärkoffer mit der eigenen Habe in Slomeks Haus. Alles andere hat die Schwiegermutter für sich behalten. Nach einem erbitterten Streit mit der Alten hat er sich geschworen, nie wieder einen Fuß in dieses Teufelsnest von Wirtshaus in Klumschitz zu setzen.
Es war bald sechs Uhr abends, als die beunruhigte Petrona sich auf den
Weg machte, den Toma zu suchen. Bei den Trojaneks erfuhr sie nur, er wäre
tatsächlich am frühen Nachmittag dagewesen, aber da der Trojanek
selber nicht daheim war, hätte der Toma nur ausrichten lassen, er käme
später wieder, es gäbe etwas Wichtiges zu besprechen. Seither
warteten sie auf ihnaber er hat sich nicht mehr blicken lassen.
Gegen Morgen kam der Toma heim, zerzaust wie ein Spatz. Ihn anzusprechen war nicht möglich. Es war ihm wohl selber peinlich zu erzählen, wo das viele Geld geblieben ist, das ihm seine Frau gutgläubig anvertraut hatte
Voll schlechten Gewissens suchte er nach irgendeiner Arbeit im Haus, und mit übertriebenem Eifer werkelte er im Hof herum. Petrona tat, als wäre er ein Fremder im Haus, wortlos stellte sie ihm das Essen auf den Tisch.
Toma aber entglitt ihr immer wieder wie ein Aal, und einmal brachte er es sogar fertig, ihre Vorhaltungen mit der Bemerkung zurückzuweisen, er habe sie schließlich nicht aus reiner Liebe geheiratet, und er denke nicht daran, weiterhin wie ein Sklave zu leben in diesem Haus am Ende der Welt, wo sich die Füchse gute Nacht sagen.
Sie konnte ihren Mann nicht einmal aus dem Haus weisen, das Gerede der Leute, die Demütigung und die Schmach hätte sie nicht ertragen können. Sie hatte vor Gott geschworen ihrem Mann zur Seite zu stehen, im Guten wie im Bösen. Nun mußte sie aus ihrer eigenen Schuld treu und mit bestem Willen zu diesem Wort stehen.
Nach zwei Jahren stand Petrona vor den Trümmern ihres Lebensglücks, versteinert, aber in ihrem Inneren unbesiegt.
Um sie herum war es still geworden, still wie im Grab, so wie auch ihr Mann dort still geworden ist. Sein plötzlicher Tod war ein unglücklicher Zufall. Im Wirtshaus, wo er Tag für Tag seine Zeit bis in die späte Nacht zubrachte, soll er volltrunken mit dem Gewehr des Försters herumgespielt haben, dabei löste sich ein Schuß und fuhr ihm durch den Kopf; ohne einen Schmerzenslaut von sich zu geben, starb er.
Der Petrona tat er nicht leid. Die Art seines Todes schien ihr die anständigste Tat seines elenden Leben zu sein; hätte er es gar absichtlich getan, so konnte sie sich wenigstens denken, daß er mit einem letzten Rest von Tapferkeit gehandelt hatte.
Aber sie, sie opferte ihrem Irrtum fast ihr ganzes Vermögen. Da trug sie nun einmal den Namen Buryja und dafür mußte sie fast den ganzen Besitz der Slomeks hergeben. Da alles zur Hälfte auf den Toma eingetragen war, kämpfte sie verzweifelt darum, wenigstens das Haus behalten zu können. Den Acker, die Weide und die Wiese in der Ebene mußte sie verkaufen. Nachdem auch noch das Vieh und alle Wirtschaftsgeräte in fremde Hand bergegangen waren, blieben ihr nur noch das Haus und ihre Bienenstöcke.
Vieles hatte ihr das Schicksal weggenommen, nur um die Ehre konnte sie es nicht bringen; die Leute durften sie nicht erniedrigen, ja, nicht einmal spotten durften sie über sie.
Ihre Ziehtochter Jenufka führte sie überall als Beweis ihrer
Ungebrochenheit mit sich. Das Kind strotzte vor Gesundheit, es war allerliebst
und immer ansehnlich wie ein Püppchen gekleidet.
»Warum nennen Sie die Jenufka ein Waisenkind, hat sie denn nicht in mir eine verläßliche Mutter?«, verteidigte sich die Buryia mit Recht.
Die Buryja lächelte glücklich, so wie immer, wenn jemand in ihrer Gegenwart ihre beispiellose Hingabe gepriesen hat. Sogar der Herr Pfarrer aus der Stadt schloß sich dem allgemeinen Lob an. Er sagte, vor ihrer gedeihlichen Ziehpflege für das Stiefkind zieht er den Hut. Und nach dem Tod des alten Küsters hat er sich gleich an sie gewandt: »Ich würde es gerne sehen, Frau Buryja, wenn jetzt Sie die Bystransche Kapelle, die zu unserer Pfarrei gehört, betreuen würden. Mir scheint, daß in Ihrer Obhut alles gedeiht.
Dies war eine öffentliche Auszeichnung! Zum ersten Mal wurde in Bystranka einer Frau das Ehrenamt des Küsters anvertraut.
Sonst war es im Haus nie traurig. Des öfteren schauten die beiden Buben aus der Mühle bei der Küsterin vorbei und werkelten im Haus nach Herzenslust. Laca, der ältere, hackte der Tante Slomek das Holz, reparierte die Wanduhr, schöpfte das Trinkwasser aus dem Ziehbrunnen und holte oftmals einen Waschtrog voll mit dem weichen Wasser vom Fluß für die große Wäsche herbei. Zu seinem jüngeren Halbruder, dem Steva, sagte er manchmal etwas trotzig: »Geh weg, du stehst nur überall im Weg!« Laca war mitunter ein wenig widerborstig, aber er hatte ein goldenes Herzfand die Küsterin, die ihn liebgewonnen hatte.
TIEF IN DIE SEELE SEHEN
Leos Janácek zu "Jenufa" und der Theorie der "Sprechmotive"
[...] Als ich die Oper Jenufa komponierte, beschäftigte ich mich intensiv mit dem Tonfall der Rede. - Verstohlen lauschte ich dem Gespräch vorbeigehender Menschen, las in ihrem Gesichtsausdruck, meine Augen verfolgten jede Regung; ich beobachtete die Umgebung der Sprechenden, ihre Gesellschaft, die Zeit und Umstände des Gesprächs - Licht und Dämmerung, Kälte und Wärme.
Den Abglanz all dessen empfand ich in den notierten Sprechmotiven. Wie viele Varianten eines und desselben Motivs fanden sich da! Hier strahlte es und schmolz, dort wurde es wieder hart und spröde. Aber ich ahnte in diesen Motiven noch etwas weit Tieferes, etwas Verborgenes, Unenthülltes. Und fühlte, daß es geheimgehaltene innere Regungen waren. Trauer las ich aus diesen Motiven, den Schimmer der Freude, der Entschlossenheit, des Zweifels usw. Kurz, sie offenbarten mir die Rätsel der Seele".
Still freute ich mich über ihre Schönheit, über das Treffende und Sparsame ihres Ausdrucks. Sinnvolle Motive entsprachen auch den Worten des Alltags. Schon das Kind kannte und verwendete sie, auch der Greis, den sie verjüngten. Einem Menschen, dessen Rede ich über die Sprechmotive lauschte, sah ich tiefer in die Seele.
In jener Zeit des intensiven Studiums der Sprechmotive - es war vor fünfzehn Jahren - entstand der 1. Akt meiner Jenufa. Ich wußte, daß ich imstande bin, die Motive beliebiger - der allgemeinsten und erhabensten - Worte zu bewältigen, ich wußte, daß ich dem Alltag des Lebens ebenso gewachsen bin wie seiner tiefsten Tragik - a u c h d e r P r o s a. U n d vertonte Jenufa in Prosa.
[...] Ich kann die Aufzählung aller Typen der Rede nicht wiederholen. Zweifellos wird der Rhythmus des Sprechens und Singens, ja der Rhythmus unserer ganzen P e r s ö n l i c h k e i t vom Leben geprägt; wir sehen und fühlen seinen Keim im Aufblitzen einer Sekunde und verfolgen seinen Ablauf in einer Zone zeitlich gegliederter Erscheinungen identischer Klarheit. Diese Zone wächst aus unserem g a n z e n S e i n: So wie sich dieses Sein bei den einzelnen Menschen unterscheidet, ist auch der rhythmische Ausdruck verschieden.
Der Schönheit und Anmut, aber auch der L e b e n s w a h r h e i t dient der Gesang; ihr leistet jeder Gesang Genüge, nicht nur das Lied; allerdings ist zu bedenken, was ihn hervorgerufen hat. War es nur die Musik, dann gehört sie zum Gesang. Sonst bedeutet jede Verbindung von Musik und Singen Gewalt am Menschen. Eine Art Umkehrung unseres Bewußtseins!
Heute erkennt man den Ruf nach lebensnahem Operngesang an, versteht aber darunter wieder nur eine Art schreienden Bombastes, der sich so schwer vertonen läßt! Opernstile kommen zur Welt. Die durch entfernte Assoziationen freigelegten Quellen der Leitmotive" sind längst versiegt, und Rebikows Mosaik wärmt mit dem schwachen Feuer des in Worten geprägten Ausdrucks, mit einem Feuer, das nur glimmt, nicht lodert.
Das Sprechmotiv strahlt eine eigentümliche Wärme, einen besonderen Glanz aus: Man schleife seine melodischen Kanten zu, verkürze oder dehne die Flächen seiner Dauer - und wie ein Edelstein wird es augenblicklich einen anderen Glanz gewinnen. Das Orchester soll das Sprechmotiv aufgreifen; auch aus den Tiefen der harmonischen Fülle wird es aufsteigen und den Klangstrom verschmelzen. An seinen Bogen halte man sich, solange es nicht gerade nachteilig ist.
Die K ü s t e r i n (duckt sich und weist vor ihrer furchtbaren Tat mit dem Finger): "Seht ihr sie da, seht ihr sie da, seht ihr sie da, seht die Küsterin!" (sie eilt in die Kamer). Mit dem Motiv des Wortes "Küsterin" erfaßt das Orchester just s i e, die Küsterin; aber jene Küsterin, die den Mord begangen hat, dessen sie das Volk bezichtigt .Nicht die Küsterin als Bühnengestalt, sondern die Küsterin dieses schicksalsvollen A u g e n b I i c k s.
Lebensnahe sind die Motive eines jeden Wortes in Jenufa. So lebensnahe, daß man sie fast s p r e c h e n könnte. Wäre es denkbar, daß ich erlauschte Sprechmotive, jene fast schmerzhaft lebendigen Fragmente aus fremden Seelen, verstohlen genommen und aus ihnen mein Werk zusammengestückelt" hätte? Wie kann man nur solchen Unsinn verbreiten?
Vielleicht habe ich damit das Wesen meiner Oper Jenufa hinreichend erklärt.
GEPRÄGTE WORTE
Ein merkwürdiges Sausen zerschellender, halblauter Worte wuchs, verstärkte
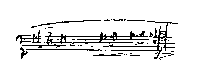
sich und fiel wieder während des langen Wartens im Vestibül des Wilson-Bahnhofes. Es war Freitag, den 13. September 1921. Fünf Minuten vor 16 Uhr verstummet es für ein kurzes Intervall. Eine donnernde Welle von Kanonenschüssen und
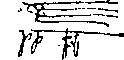
der scharfe Befehl
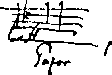
Posor Achtung!
fiel in die stehende Stille. Unter dem Hellen schmettern der Militärtrompeten trat Präsident T. G.Masaryk unter uns. Ich präge einige der bedeutenden Worte des Präsidenten in den Tönen seiner eigenen Redeweise.
Auf die Ansprache des Vorsitzenden des Landes-ausschußes sagte er:
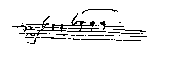
Co jsem vykonal . . .
"Was ich in der historischen Zeit des Kampfes für unsere Befreiung getan habe, ist nichts anderes, als was ich mich bemühte, stets zu tun. Meinem Volke in dem zu nützen, was gerad notwendig und wie es am besten möglich war. Das ist auch heute stets die Pflicht
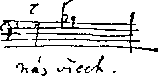
nás wschech von uns allen.
Werke des Aufbaues unseres Staates erreichen wir nur
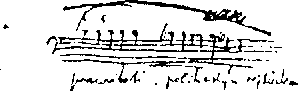
prazowitostji politizkím roshledem (durch Arbeitsamkeit und politische Umsicht).
Von Gefühlen spreche ich nicht gern.
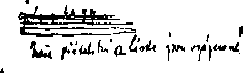
nasche prshátestwí Unsre Freundschaft und Liebe sind gegenseitig.
Aus der Antwort auf die Ansprache des Bürgermeisters von Brünn:
"Sie sagen, daß
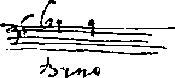
Brno Brünn
jetzt anders ist. Brünn war sicher lange seine Vorstadt Wiens . . . "
Aus der Antwort auf die Ansprache des Dr. Engli, am Samstag, den 17.9. :
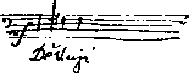
Djekuji Ich danke,
Herr Prorektor, Ihnen und Ihren Kollegen für die Begrüßung. Sicherlich kann ich meine Staatsaufgaben nicht anders erfassen, als die
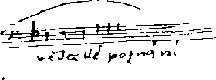
wjedeske posnanji wissenschaftliche Erkenntnis
dieses Gebietes bestimmt . . .
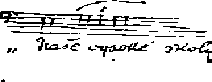
nasche wissoke skoli unsere Hochschule
werden selbstverständlich die Wissenschaften und daher auch die wissenschftlichen Fachkenntnisse pflegen, aber
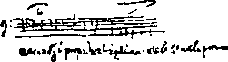
nessmjei propadatji uskemu intllektualismu sie dürfen nicht dem begrenzten Intelektualismus verfallen.
Die Intelligenz ist heute berufen
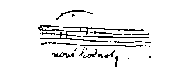
nowé hodnoti neue Werte
zu schaffen. Ihre Worte, Herr Professor, sind mir ein Beweis, daß die Lehrerschaft unserer Hochschulen ihre schöbe, wenn auch verantwortungsvolle Aufgabe
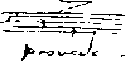
prowede erfüllen wird.
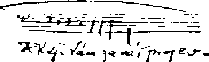
Djekuji wam sa wasch projew Ich danke für Ihre Ansprache.
Aus der Antwort auf die Ansprache eines Redners aus der Studentenschaft: "Ich lehrte die Studenten, aber ich habe auch
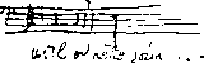
utschil od njeho sam selbst von ihnen gelernt
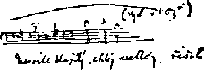
mussite kaschdi, chjej nechtjej Ihr müßt alle, ob ihr wollt oder nicht,
(ausgesprochen in 1, 07 Sekunden)
das Problem des Lebens lösen. Es gibt Staaten und Staaten. Wir wollen und müssen ein
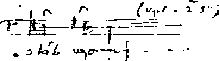
stat wsorni Musterstaat
werden. (ausgesprochen in 2,5 Sekunden.)